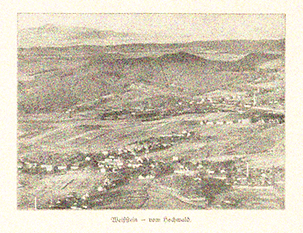Familiengeschichte Lempert
Die deutsche Perspektive

Unsere Recherche brachte uns zum Haus Schlesien in der Nähe von Bonn, ein Erinnerungsort der schlesischen Kultur[1]. Wir besuchten dort die Ausstellung und sprachen gerade mit der Bibliotheksleiterin als ein Mann auf uns zu kam. Er stellte sich als Manfred Lempert vor und erzählte uns von seiner Erinnerung an die Vertreibung, als er noch ein Kind war. Wir haben ihn später nochmals telefonisch kontaktiert und am 4. Januar 2025 ein Interview mit ihm in seinem Zuhause durchgeführt. Wir wurden herzlich von ihm empfangen und nach einer Weile fingen wir an mit dem Gespräch.
1. Einleitung
Herr Lempert sprach über seine Erinnerungen in Schlesien während und nach dem Krieg, als auch von seiner Reise und Ankunft in der britischen Besatzungszone. Allerdings muss man dies in den historischen Kontext setzen, deshalb werden wir zunächst über die verschiedenen Phasen der Migration aus den Ostgebieten und über seine Heimat sprechen
Abbildung 1. Haus Schlesien mit dem Denkmal Gerhart Hauptmanns

2. Die Flucht und wilde Vertreibungen der Deutschen aus den Ostgebieten
Zwischen 1944 und 1950 waren insgesamt 12 bis 18 Mio. Deutsche aus den ehemaligen Ostgebieten geflüchtet oder vertrieben worden - die Schätzungen von Historikern gehen hier auseinander[2]. Die Lage sowie Organisation waren sehr schlecht und die Evakuierung verlief chaotisch. Circa 1 bis 2 Mio. Menschen kamen auf der Flucht ums Leben, aber auch diese Opferzahlen sind stark umstritten. Zu den Hauptursachen der Toten zählten Kälte, Erschöpfung, Krankheiten und Bombardierungen[3]. Dazu kommt noch, dass viele Frauen und Mädchen vergewaltigt wurden. Die Forscherin Marion Gebhardt schreibt, „dass es aufgrund der Quellen- und Forschungslage unmöglich ist, die Anzahl der Vergewaltigungsopfer auch nur annähernd genau zu bestimmen. Von keiner Besatzungsmacht ist das Thema bislang systematisch aufgearbeitet worden“[4].
Am Anfang befahl und organisierte die deutsche Verwaltung die Evakuierung, unter äußerst schwierigen Umständen. Die Umsiedlung begann in Ostpreußen, als am 16. Oktober 1944 die sowjetische Armee die deutsche Grenze überschritt. Rotarmisten massakrierten in vielen Orten die Zivilbevölkerung. Über 2 Mio. Menschen versuchten zu fliehen, der Großteil davon mit Zügen. Die Transporte mit den Menschen wurden zugunsten des Abtransports von Industrieobjekten angehalten. Viele nahmen den Seeweg, welcher jedoch kein sicherer Fluchtweg war, wie die Versenkung des Schiffes Wilhelm Gustloff mit etwa zehn Tausend Flüchtlingen aus Ostpreußen zeigte[5]. Aufgrund des späten Evakuierungsbefehls blieben die Schiffe in Pommern als einziger Weg übrig. Über 1 Mio. Flüchtlinge verließen unter chaotischen Umständen die Region. Auch die Evakuierung von Niederschlesien und Oberschlesien begann zu spät und war nicht gut geplant. Es gab zu wenige Transportmittel für die über 3,2 Mio. Einwohner. Am 19. Januar 1945 wurde der Befehl zur Evakuierung Breslaus gegeben. Viele überlebten den Marsch Richtung Sachsen im Winter nicht und Tausende kamen bei der Bombardierung Dresdens ums Leben[6].
Nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945, noch vor den internationalen Beschlüssen über die Umsiedlung aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn, gab es „wilde Vertreibungen“. Für die Zivilbevölkerung war diese Zeit durch Gewalt und Plünderungen geprägt. Viele Deutsche wurden in Internierungslagern und Gefängnissen inhaftiert. Es gab auch Todesmärsche, wie der Brünner Todesmarsch (Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus Brünn in Mähren)[7], bei dem viele Frauen und Kinder sowie alte Männer ums Leben kamen[8]. Am 28. August 1945 notierte James Wagner, ein Soldat der britischen Armee, folgende Worte: „Europa ist wieder in Bewegung: mit dem Zug, zu Fuß, mit dem Wagen, mit dem Auto und sogar mit dem Schiff auf Flüssen und an der Ostseeküste.“[9]

3. Organisation der geplanten Vertreibung
Auf der Potsdamer Konferenz wurden die neuen Staatsgrenzen in Ostmitteleuropa vorläufig geregelt und eine Zwangsumsiedlung der Bevölkerung beschlossen, die „auf eine geordnete und humane Weise“ erfolgen sollte[10]. Dazu bestätigte man in dieser Konferenz das Abkommen über die Kontrolleinrichtungen in Deutschland, welches schon im Jahr davor von der UdSSR, England und den USA unterzeichnet wurde. Die Besatzungsbehörde, genannt der Alliierte Kontrollrat, bestand aus den Oberbefehlshabern der drei Siegermächte und Frankreich. Diese waren für die einzelnen Besatzungszonen verantwortlich, sollten aber für das ganze Deutschland miteinander kooperieren[11].
In der Sitzung des Kontrollrats am 01. Februar 1946 in Berlin wurden unter anderem auch die Einzelheiten der Transport der sogenannten Displaced Persons geklärt. Dies bedeutet auf Deutsch so viel wie „Heimatlose“, darunter zählen Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Flüchtlinge und befreite KZ-Insassen. Im Protokoll Plan for the Transfer of the German Population wurde festgelegt, dass die 3,5 Mio. Deutschen in Polen zwischen der sowjetischen und der britischen Besatzungszonen aufgeteilt würden. Die weiteren 3,15 Mio. Deutschen aus dem Sudetenland und weiteren südöstlichen Ländern würden von den Sowjets, Amerikanern und Franzosen aufgenommen. Beide Zahlen waren aus verschiedenen Gründen stark unterschätzt, was zu einer Verschlechterung der Umsiedlungszustände beitrug.
Nach der Konferenz sollten die jeweiligen Verwaltungsmächte die Umsiedlungsaktion koordinieren, z.B. druckte die polnische Regierung Sonderbefehle und andere Bekanntmachungen. Ein Beispiel für einen solchen Druck wäre das vielveröffentlichte Blatt aus Bad Salzbrunn in Schlesien, nicht weit vom Wohnort unseres Zeitzeugen Manfred Lempert. In manchen Orten wurden den Familien Benachrichtigungen über die Vertreibung individuell gesendet.
Am 14. Februar 1946 wurde ein polnisch-britisches Abkommen zur Umsiedlung von Deutschen aus Westpreußen, Niederschlesien und Danzig in die britische Zone beschlossen (Aktion Swallow/ Schwalbe) und 5 Tage später fuhr der erste Aussiedlertransport aus Niederschlesien los. Die Briten verpflichteten sich täglich 6.200 Personen aufzunehmen[12]. Seitens Polen übernahm das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete (Ministerstwo Ziem Odzyskanych) die Koordination. Für die technische Umsetzung war das Staatliche Heimkehramt (Państwowy Urząd Repatriacyjny – PUR) zuständig. Es war vereinbart, dass die Transporte bis zu Stationen in Kohlfurt in Schlesien und Stettin in Pommern, und weiter zu den Sammelstellen in Mariental, Friedland und Bad Segeberg fahren würden[13].
Die Alliierten beschlossen, dass die Familien nicht getrennt werden sollten und Kranke und Alte in Sondertransporten fahren würden. Zuerst wurde die Stadtbevölkerung abtransportiert. Man durfte 40 kg Handgepäck mitnehmen, inklusive Reiseproviant. Der restliche Besitz wurde konfisziert. Die Deutschen mussten weiße Armbinden mit N für Niemiec (Deutsche/-r) tragen, bis sie die deutsch-polnische Grenze überschritten. Sie gelangten meistens zu Fuß zu den Sammelpunkten und wurden in Güterwagons abtransportiert. Trotz der beschlossenen Regelungen waren die Hygienezustände und Lebensmittelversorgung oft miserabel.
Deutsche Spezialisten, die relevant für die Instandhaltung der Infrastruktur in den verlorenen Gebieten waren, wurden mit Anforderungsanträgen zurückgehalten. Ein Beispiel wäre das Bergbaugebiet in Kreis Waldenburg, wo eine deutsche Minderheit von Bergmannsfamilien blieb. Dieser wurde 1951 überwiegend die polnische Staatsangehörigkeit zugesprochen und sie genoss in den folgenden Jahren die Sonderrechte im Schulwesen und kulturellen Belangen als anerkannte Minderheit. In der zweiten Hälfte dieser Dekade zogen fast alle aus dieser Gruppe in die BRD um[14].
Am 5. Mai 1946 wurde das polnisch-sowjetische Abkommen über die Aussiedlung in die sowjetische Zone unterzeichnet. Ein neues Abkommen mit der UdSSR wurde am 12. April 1947 beschlossen, welches die Umsiedlung der restlichen Deutschen Bevölkerung betraf[15]. Das größte Gebiet, das Deutschland verloren hatte, mit der höchsten Bevölkerungszahl von über 3,2 Mio.[16] war Schlesien, die Heimat unseres Zeitzeugen Manfred Lempert.
Abbildung 2. Sonderbefehl für die Bevölkerung der Stadt Bad Salzbrunn, 14.07.1945
Abbildung 3. Individuelle Benachrichtigung über die Vertreibung, mit dem Wort „niemiec“ (deutsche-/r) absichtlich klein geschrieben, Wołów, 9.08.1946
Abbildung 4. Armbinde für die deutschen Vertriebenen, 1945

4. Schlesien – eine verlorene Heimat
Schlesien, eine Provinz an der Kreuzung der Bernsteinstraße von Norden nach Süden und der Handelsstraße von Osten nach Westen, war geprägt durch den Austausch zwischen verschiedenen Kulturräumen. Die Landessprache in dieser Provinz war jahrhundertelang Deutsch. Außerdem war diese Region seit der Renaissance eine Schreibstube deutscher Dichtkunst. Ein klassisches Beispiel sind die Werke des Barocklyrikers Andreas Gryphius, dessen Gedicht „Tränen des Vaterlandes“, zeigt, dass Schlesien ein fester Teil der deutschen Heimat war.
Das 19. Jahrhundert mit der Nationalbewegung war für die Identitätsstiftung besonders wichtig. Die historischen Ereignisse wurden in der Literatur thematisiert. Ein Beispiel ist der bekannte schlesische Weberaufstand von 1844, der durch das Drama "Die Weber" vom Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann verewigt wurde. In Schlesien tätige Künstler prägten deutschlandweit das Kulturleben, wie z. B. der in Oberschlesien schaffende Schriftsteller Joseph von Eichendorff, einer der meistvertonten deutschsprachigen Lyriker[17]. Im Garten des Haus Schlesien erinnert ein Gedenkstein an Eichendorff und ein Denkmal für Gerhart Hauptmann steht prominent vor der Fassade des Museums.
Hauptmann selbst, geboren in Bad Salzbrunn, war mit Schlesien sehr verbunden und wollte seine Heimat nach 1945 nicht verlassen. Er bekam einen Schutzbrief eines sowjetischen Kulturoffiziers und konnte einige Zeit noch bleiben, obwohl die polnische Regierung das nicht willkommen hieß. Der Nobelpreisträger starb am 6. Juni 1946 in Agnieszków[18] in Polen, welches er wahrscheinlich bis zu seinem Tode Agnetendorf nannte, wie der Ort mehrere Jahrhunderte hieß. Er verfügte testamentarisch in schlesischer Erde begraben zu werden, sein Wunsch wurde jedoch nicht erfüllt. Ein Monat nach dem Tod wurden die sterblichen Überreste Hauptmanns und ein Säckchen Riesengebirgen Erde nach Deutschland transportiert und auf Insel Hiddensee bestattet.
Abbildung 5. Gedenkstein Joseph von Eichendorffs vor dem Haus Schlesien

5. Vertreibungsgeschichte der Familie Lempert
Als die letzte Reise von Hauptmann begann, war Manfred Lempert bereits in der britischen Zone. Auch er, wie viele aus seiner Generation, nennt Hauptmann als Träger deutscher Kultur, wenn er über die verlorene Heimat spricht. Man spürt in seinen Worten eine Wertschätzung und etwas Nostalgie für die Region. Seine Haltung ist ähnlich, wie die von Marion Gräfin Dönhoff: „Lieben, ohne zu besitzen“[19]. In der Erzählung von Manfred Lempert kann man zwischen den Sätzen raus hören, dass er die verlorene Heimat immer noch im Herzen trägt.
Seine Heimatstadt war Weißstein im Waldenburger Bergland, angrenzend am Geburtsort von Gerhart Hauptmann, Bad Salzbrunn. Weißstein ist ein Bergbauort, malerisch umgeben vom Eulengebirge[20]. Nach dem Ersten Schlesischen Krieg 1742 fiel Weißstein an Preußen zusammen mit fast ganz Schlesien. Es war ein Industrieort mit mehreren Steinkohlebergwerken und mit ca. 17.000 Einwohner zu Beginn des zweiten Weltkrieges. Im Ort gab es eine katholische und eine evangelische Kirche.
Die letztere wurde in den 60er Jahren abgerissen, woran sich Herr Lempert erinnert. Die Kirchen mit dem Kriegerdenkmal, das vor der evangelischen Schule stand, waren oft auf Postkarten verewigt. Das Denkmal für die Gefallenen des Krieges 1870-71 stellte eine Figur der Germania mit Schwert dar, und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen. Es gab viele regionale Sagen und Legenden, die die kollektive Fantasie in Schlesien prägten. Auch im Waldenburgerland spielte der bekannteste Berggeist des Riesengebirges Rübezahl[21] eine Rolle.
Interessanterweise war das erste Buch, dass in Schlesien 1945 in polnischer Sprache veröffentlicht wurde, eine Sammlung von übersetzten Rübezahl-Sagen. Der Berggeist war politisch und national neutral und konnte die neuen Einwohner Schlesiens weiterhin begleiten, im Gegensatz zur vielen anderen deutschen Kulturträgern, die über Jahrzehnte nach dem Krieg verdrängt oder vergessen wurden. Wichtig für die regionale Identität war natürlich auch Bad Salzbrunn, ein Kurort mit dem 1932 errichteten Gerhart Hauptmann Gedenkstein, der der Grenzverschiebung zum Opfer fiel wie viele andere Denkmäler. Erst sieben Jahrzehnte später wurde in Bad Salzbrunn der neue Gerhart Hauptmann Gedenkstein in Anwesenheit der deutschen und der polnischen politischen Vertreter eingeweiht[22]. Eine besondere Bedeutung für die Kulturlandschaft der Region hatten das 10 km nördlich von Weißstein liegende Schloss Fürstenstein (heute Książ) und natürlich die 70 km entfernte Großstadt Breslau (heute Wrocław), das Bildungs- und Industriezentrum Schlesiens.
Die kulturellen, historischen und sozialen Umstände der Region spiegeln sich auch in den persönlichen Erinnerungen ihrer Bewohner wider. Einer dieser Zeitzeugen ist Manfred Lempert, geboren im Jahr 1936, der in seiner frühen Kindheit das NS-Regime in Schlesien erlebte. Die Familie wohnte in Weißstein bei Waldenburg. Sein Vater, ein Postbeamter in Bad Salzbrunn, wurde 1943 zum Volkssturm in Breslau eingezogen und geriet später in russische Kriegsgefangenschaft in der Ukraine[23]. Die Mutter blieb allein mit vier Kindern, von denen Herr Lempert mit neun Jahren der Älteste war, zurück. Er erinnert sich noch sehr gut an seine Schulzeit, in der er die Lehrer mit dem Hitlergruß begrüßen musste, um eine Strafe zu vermeiden. Jedoch schloss die Schule schon 1944[24].
Am Ende des Krieges begannen die NS-Führer die Konzentrationslager durch Todesmärsche zu leeren, um ihre Tätigkeiten zu verbergen. Dies galt auch für das KZ Gross-Rosen, nicht weit von Weißstein entfernt. Die Inhaftierten marschierten 50 km bis zu dem nah an der Stadt gelegenem Wald. Auf dem Weg durch die Stadt waren ein paar Häftlinge so geschwächt, dass sie nicht weiterkonnten, und wurden vor den Augen der Kinder von SS-Männern erschossen[25].
Die Situation verschlimmerte sich nach der Kapitulation der Deutschen im Mai 1945 und dem darauffolgenden russischem Einmarsch und Besatzung Schlesiens. Am 8. Mai wurde Waldenburg und seine Umgebung durch Truppen der 1. Ukrainischen Front der Roten Armee kampflos besetzt[26]. Irgendwann danach wurde die Mutter, Emma Lempert, mit ihren vier Kindern in einer sogenannten Kurzvertreibung zum nächsten Dorf verjagt. Nach wahrscheinlich nur einer Übernachtung durften sie wieder zurück nach Hause. Sie waren gerade auf dem Rückweg im Wald, als ein russischer Soldat ihnen entgegenkam. Nach einer Androhung die Kinder zu erschießen, zog er die Mutter in den Wald und vergewaltigte sie[27]. Wie schon erwähnt, passierten solche Vergewaltigungen oft und führten häufig zu ungewollten Schwangerschaften.
Anfang Mai 1946 kamen die polnischen Soldaten, die der Familie befahlen das Haus zu verlassen. Da schon vor dieser Zeit die Rede über eine Vertreibung gewesen war, hatte Herr Lemperts Mutter einen Brotbeutel mit den wichtigsten Dokumenten und Fotos vorbereitet und auf die Kommode gelegt. Als die Soldaten warteten, packte die Familie noch schnell ihre letzten Sachen. Der Schlüssel war schon den Soldaten übergeben worden, als die Mutter merkte, dass sie in der ganzen Hektik den Brotbeutel vergessen hatten. Sie flehte die Soldaten an die Tür zu öffnen, jedoch brachte dies nichts und sie mussten ohne die wichtigen Papiere und Erinnerungsstücke abreisen[28]. Dann führten die Soldaten die Familie zu Fuß zu dem Altwasser Bahnhof, welcher 3,6 km entfernt lag. Die Lemperts wurden in ein verlassenes Gebäude ohne Sanitäranlage in der Nähe des Bahnhofs gebracht, der als eine temporäre Unterkunft für viele deutsche Familien aus der Gegend diente[29].
Nach einiger Zeit wurden die gesammelten Familien zum Bahnhof gebracht, um Viehwagons zu besteigen. Irgendwann bekamen sie hier das Erkennungszeichen der Vertriebenen, eine weiße Armbinde mit dem Buchstaben „N“ für das Wort „Niemiec“ (Deutscher). Man durfte nur wenige Habseligkeiten und Essen mitbringen (nur 40 kg[30]) und dazu stiegen pro Wagon ca. 50 Personen ein, sodass man die meiste Reise im Stehen verbrachte. Als der Zug wegfuhr, fingen die Menschen an schlesische Heimatlieder zu singen und zu weinen. Nach ein paar Tagen erreichte der Zug den Eisenbahnknotenpunkt Kohlfurt, der sich ungefähr 110 km von Altwasser befand. Dort wurden die Vertriebenen aus den Zügen geholt und mit einer staubartigen Substanz desinfiziert[31].
Dann ging es weiter mit dem Zug nach Deutschland durch Görlitz über die Görlitzer Neiße. Sobald der Zug den Fluss überquerte, nahmen die Vertriebenen die weißen Binden ab und warfen sie in den Fluss hinein. Dies zeigte, wie erniedrigend das Erlebnis für sie war.
Soweit sich Herr Lempert erinnert, machte der Zug keinen Halt in der russischen Besatzungszone. Nach weiteren Tagen und ca. 320 km, erreichte er Marienborn in der britischen Zone. Dort bekam Manfred Lempert und andere Vertriebenen endlich eine richtige Mahlzeit nach langer Zeit des Hungers. Am 17. Mai 1946 wurde der Flüchtlings-Meldeschein im Flüchtlingslager Mariental erstellt, den Manfred Lempert bis heute besitzt[32].
Mariental gehörte neben Friedland zu den wichtigsten Grenzdurchgangslagern für die Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten. Nach Friedland wurden später die sogenannten Spätaussiedler gebracht, heute gibt es dort eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Niedersachsen. Am 18. März 2016 wurde in Friedland ein Museum geöffnet, das die Geschichte des Grenzdurchgangslagers erforscht und präsentiert. Zur Geschichte des Durchgangslagers in Mariental und Alversdorf dagegen fanden wir wenig, obwohl das eine wichtige Stelle für die Umgesiedelten war. Dank eines Online-Beitrags im Braunschweigischen Geschichtsblog „Die Durchgangslager in Mariental und Alversdorf“ aus dem Januar 2023 erfahren wir lediglich, dass 2010 ein Denkmal vor Ort errichtet worden ist. Durch Mariental kamen über 533.000 Vertriebene in 303 Transporten[33]. Die Situation der Vertriebenen schildert ein Bericht aus dem Jahr 1946: „Als im November 1946 noch ein Treck aus Schlesien mit 1.800 Menschen kam, worunter auch ich mich befand, war das Lager überfüllt. Ca. 5.000 Menschen lagen in Baracken aus Holz oder Stein, dreißig, vierzig, fünfundvierzig Menschen in einer Stube von 45 qm, Männer, Frauen und Kinder zusammen in einem Raum.“[34]
Später fuhr der Zug mit den Lemperts ca. 240 km weiter westlich nach Warendorf. Die Familien wurden dort in einem verlassenem Pferdegestüt untergebracht. Eine Familie bekam jeweils eine kleine Pferdebox mit Stroh zugewiesen. Manfred Lempert erinnert sich nicht gerne an die Zeit. Nach einigen Tagen verlegte man die Vertriebenen wieder, diesmal mit Hilfe von Fuhrwerken. Man brachte sie in die verlassene psychiatrische Klinik in dem 35 km nördlich liegendem Lengerich. Die Klinik war zu der Zeit in Folge der sogenannten Aktion T4 schon leer[35]. 222 psychisch Kranke wurden 1941 aus der Lengericher Klinik in die Tötungsanstalt Hadamar deportiert und anschließend getötet[36].
Die letzte Reise, die Herr Lempert mit seiner Familie gemeinsam unternahm, war nach Recke, 25 km nördlich von Lengerich. Die Familie wurde früh am Morgen dort hingebracht, jedoch wurde die Aufteilung der Vertriebenen in die Haushalte der Einheimischen noch nicht organisiert. Sie warteten mit anderen Familien auf dem Bürgersteig bis zum späten Nachmittag, dann transportierte man sie zum Ortsteil Steinbeck. Der neun-jährige Manfred Lempert und zwei seiner jüngeren Geschwister wurden von seiner Mutter getrennt, nur der Kleinste blieb bei ihr. Die Trennung sollte wohl ihre Aufnahme bei den Familien vereinfachen. Die drei älteren Kinder wurden auch aufgeteilt und in verschiedenen Haushalten aufgenommen. Herr Lempert beschrieb diese Situation mit Wörtern wie „rücksichtslos weggenommen“ und „auseinandergerissen“, was zeigt, wie unerwartet und traumatisch das für die kleinen Kinder war[37].
Die Ersten, die den jungen Manfred Lempert aufnahmen, waren eine Bergmannsfamilie, bei der er sich sehr wohl fühlte und dort in die Schule gehen konnte. Er blieb bei ihnen von Mai bis Oktober 1946, dann musste er aus unbekannten Gründen weggehen. Er wurde später bei einem Bauern untergebracht und musste bei ihm auf dem Feld arbeiten, um zu bleiben. Doch einen Monat später kam er zu einer sehr freundlichen Familie, die ihn wie ihr eigenes Kind behandelte. Herr Lempert blieb bei ihnen für drei Jahre. In dieser Zeit kam auch sein Vater aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Er konnte ihn nicht auf den ersten Blick erkennen, da sein Vater so abgemagert war.
Aus der Gefangenschaft hatte der Vater, Alfred Lempert, Postkarten durch das russische Rote Kreuz und Roten Halbmond an die alte Familienadresse in Weißstein versendet, die nie bei der Familie ankamen[38]. Als er frei gelassen wurde, fuhr er zu seinem Bruder in Berlin und arbeitete dort eine Weile. Durch den Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes fand er endlich die Familie.
Es dauerte eine Weile, bis die Lemperts zusammen in einem Haus leben konnten. Nach der Ankunft des Vaters bekam die Familie ein Heuerhaus zugeteilt. Die Zustände waren sehr primitiv, ein Zimmer für fünf Personen, sodass Manfred Lempert noch bei der Gastfamilie bleiben musste. Danach wurden sie in einer Einzimmerwohnung in Recke einquartiert. Diese war so klein, dass das in der Zwischenzeit geborene Kind in einer Schrankschublade schlief, da kein Kinderbett mehr ins Zimmer reinpasste. Der Vater schrieb die Alliierten Behörden an, um eine größere Unterkunft für seine Familie zu beantragen. Sie bekamen die Zuweisung zum Einzug in das Haus eines einheimischen Viehhändlers. Als sie bei ihm zu Fuß ankamen, wies er sie mit einem Gewehr und Hund zurück. Damals hörte Manfred Lempert wie seine Familie als „Rucksackdeutsche“ und „Polacken“ bezeichnet wurde. So kamen sie wieder in die Einzimmerwohnung. Später zogen sie in ein Behelfsheim aus Stein ein, wo Herr Lempert sich der Familie endlich anschloss.
Abbildung 6. Weißstein von Hochwald, 1926
Abbildung 7. Postkarte aus Weißstein mit den 2 Kirchen, 1900
Abbildung 8. Postkarte mit dem Bahnhof in Kohlfuhrt, Angang 20. Jahrhunderts
Abbildung 9. Flüchtlings-Meldeschein Nr. 134895, Manfred Lempert, Mariental, 17.05.1946
Abbildung 10. Postkarte aus russischer Kriegsgefangenschaft, Alfred Lempert, wahrscheinlich 1944
Zu dieser Zeit arbeitete sein Vater als Fährmann, versuchte jedoch eine Stelle bei der Post wiederzubekommen. Dies erwies sich als sehr schwierig, da, wie schon erwähnt, die ausweisenden Dokumente in Weißstein geblieben waren. Deshalb schrieb der Vater ehemalige Arbeitskollegen aus der Reichspost in Bad Salzbrunn an, die auch nach Deutschland vertrieben worden waren. Einige von ihnen sendeten ihm schriftliche Bestätigungen, dass er vor und während des Krieges im Salzbrunner Postamt gearbeitet hatte. Dank dieser Aussagen bekam der die Möglichkeit in den Dienst zurückzukehren, was zu einer Verbesserung der Wohnumstände der Familie führte[39].

6. „Kalte Heimat“
Im Gegenteil zu der humanen Aufnahme Herr Lemperts, gab es für viele Vertriebenen kalte Blicke und Beschimpfungen von den einheimischen Deutschen. Die nationalsozialistische Rassentheorie, bestehend aus Antisemitismus, Antiziganismus und Antislawismus, lebte in Köpfen vieler Deutschen weiter. Sie nannten die Vertriebenen „40-Kilo-Zigeuner“ oder „Zigeunerpack“, obwohl sie auch blond und blauäugig waren. Ein anderer Name für die Vertriebenen war „Polacken“, angesichts des Faktes, dass sie aus dem verachteten Osten kamen und die kulinarischen Gewohnheiten der Slawen mitbrachten. Darüber hinaus warf man ihnen noch den preußischen Militarismus vor, demzufolge stünden die Vertriebenen angeblich dem Nationalsozialismus näher und stellten insofern eine Gefahr für die sich aufbauende Demokratie dar[40].
Im November 1947 endete die organisierte Massenaussiedlung der Deutschen. Die Vorurteile der westdeutschen Bevölkerung gegenüber der Östlichen blieben aber noch lange bestehen und wurden öffentlich ausgesprochen, wie in der Rhein-Neckar-Zeitung im April 1948 zu lesen war: „Die Flüchtlinge sind grundsätzlich schmutzig. Sie sind grundsätzlich primitiv, ja sind sogar grundsätzlich unehrlich. Dass sie faul sind, versteht sich am Rande.“[41] Das „Eingliederungswunder“ in der BRD, wovon man stolz in den 60er Jahren sprach, hätte es ohne den Einsatz der Polizei und der deutschen sowie alliierten Militärkraft nicht gegeben. Diese zogen mit Mitarbeitern der Landesämter durch die Dörfer, um wenig benutzte Gebäude oder Räume als Unterkunft für die Vertriebenen zu finden. Der Rest wurde unter den Bauern aufgeteilt, wobei es wie auf einem Sklavenmarkt vorging. Die Stärksten und Schönsten wurden als erste gewählt, der Rest vom Volk verhöhnt. Bei Familien mit vielen Kindern, wie die Manfred Lemperts, mussten die Kleinen oft von den Eltern getrennt werden, um überhaupt von den Einheimischen aufgenommen zu werden[42].
Nach der Ankunft waren innerhalb der BRD zwei Hilfsmittel für die Vertriebenen wichtig: die Soforthilfe und der endgültige Lastenausgleich. Die Soforthilfe, im Gesetz zur Behebung dringender Notfälle vorgesehen, bestand aus finanzieller Unterstützung für lebensnotwendige Produkte, Haushaltsmittel sowie Schulartikel. Am 1. September 1952 trat das Lastenausgleichsgesetz in Kraft[43], dessen Auszahlungen hauptsächlich zur Sachentschädigung, Förderung des Wohnungsbaus und Zahlung der Renten benutzt wurden.
In der DDR hingegen gab es offiziell weder ein Programm noch ein Gesetz zur Sachentschädigung der Vertriebenen. Zwar wurden sie bei der Landvergabe nach der Bodenreform im September 1945 bevorzugt, sie wurden jedoch in keiner Form bei der Ausstattung der Höfe oder Behausung unterstützt[44]. Im Vergleich zum Westen lag die Umverteilung des Eigentums der Einheimischen, insbesondere des Wohnraums, meistens zugunsten der Umsiedler. Da jeder vierte Einwohner der DDR zu den Vertriebenen gehörte, war das besonders wichtig. Im September 1950 wurde das Gesetz über die weitere Verbesserung der Lage der ehemaligen Umsiedler beschlossen, welches die Integrationsmaßnahmen beschrieb[45]. Dabei war der offizielle Begriff „Umsiedler“ bedeutend, der implizierte, dass es sich um eine geplante, legale Umsiedlung handelte und sollte das Unrecht und Leid der Vertriebenen ausblenden. Im selben Jahr unterzeichnete man das Görlitzer Abkommen, was die Tabuisierung des Vertreibungsthemas verstärkte[46]. Im Osten war eine Gründung von Interessensverbänden der Vertriebenen nicht möglich, im Gegenteil zu der BRD.
Aus heutiger Perspektive, unabhängig von der Erinnerungskultur der stummen DDR oder der kontroversen BRD, besteht bei Vielen das Heimatverlustgefühl, das tiefe Wunden hinterlassen hat. Obwohl diese Ereignisse schon 80 Jahre zurückliegen, sind sie im Gedächtnis der Vertriebenen immer noch präsent. Die traumatischen Situationen, die Herr Lempert erlebt hat, wie der Totenmarsch der Häftlinge oder die Vergewaltigung seiner Mutter, begleiten ihn bis heute. Die Vertreibung von Manfred Lempert und seiner Familie ist eine von Millionen Geschichten, die noch zu hören sind.
[1] https://www.hausschlesien.de/, Zugang 17.01.2025.
[2] Sienkiewicz, Witold; Hryciuk, Grzegorz (hg.), Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939-1959. Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas, Bonn, 2010, S. 175.
[3] Sienkiewicz, Witold; Hryciuk, Grzegorz (hg.), Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939-1959. Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas, Bonn, 2010, S. 173.
[4] Dokumentation Vergewaltigungen von Frauen im Zweiten Weltkrieg. Ausgewählte Literatur zu Schätzungen der Anzahl, https://www.bundestag.de/resource/blob/872014/6f0f8229e73376473c576aa0aba143b2/WD-1-023-21-pdf-data.pdf, Zugang 17.01.2025.
[5] Sienkiewicz, Witold; Hryciuk, Grzegorz (hg.), Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939-1959. Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas, Bonn, 2010, S. 170.
[6] Sienkiewicz, Witold; Hryciuk, Grzegorz (hg.), Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939-1959. Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas, Bonn, 2010, S. 175.
[7] Heutige tschechische Ortsname: Brno.
[8] Der Brünner Todesmarsch, https://kulturstiftung.org/zeitstrahl/der-bruenner-todesmarsch, Zugang 17.01.2025.
[9] Zitiert nach: Heise, Volker, 1945, Berlin, 2024, S. 371.
[10] “The Three Governments, having considered the question in all its aspects, recognize that the transfer to Germany of German populations, or elements thereof, remaining in Poland, Czechoslovakia and Hungary, will have to be undertaken. They agree that any transfers that take place should be effected in an orderly and humane manner.”, Report On The Tripartite Conference In Berlin, 1945 (Potsdam Conference), Library of Congress Digital Collections, https://maint.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000003-1224.pdf, S. 14, Zugang 22.01.2025.
[11] Alliierter Kontrollrat, https://d-d-r.de/alliierter-kontrollrat.html#:~:text=Entsprechend%20waren%20diese%20die%20Repr%C3%A4sentanten,Lattre%20de%20Tassigny%20f%C3%BCr%20Frankreich, Zugang 07.01.2025.
[12] Sienkiewicz, Witold; Hryciuk, Grzegorz (hg.), Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939-1959. Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas, Bonn, 2010, S. 191.
[13] Sienkiewicz, Witold; Hryciuk, Grzegorz (hg.), Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939-1959. Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas, Bonn, 2010, S. 188 u. f.
[14] Waldenburg/Wałbrzych, Abschnitt „Zeitgeschichte“, https://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/orte/waldenburg-walbrzych, Zugang 19.01.2025.
[15] Sienkiewicz, Witold; Hryciuk, Grzegorz (hg.), Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939-1959. Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas, Bonn, 2010, S. 188.
[16] Sienkiewicz, Witold; Hryciuk, Grzegorz (hg.), Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939-1959. Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas, Bonn, 2010, S. 175.
[17] Literarische Landschaft Schlesiens ist umfangreich beschrieben in: Schieb, Roswitha, Literarischer Reiseführer Breslau: Sieben Stadtspaziergänge, Potsdam, 2009, S. 350 u. a.
[18] Seit 1947 lautet der Ortsname Jagniątków.
[19] Marion Dönhoff war eine aus Ostpreußen stammende Publizistin und eine Wegbereiterin für die Versöhnung und Verständigung zwischen Polen und Deutschen. Siehe: Stern, Fritz, Fünf Deutschland und ein Leben. Erinnerungen, München, 2007, S. 339.
[20] Richter, Adolf, Chronik von Weißstein - Kreis Waldenburg i. Schl. Eine fränkische Bauernsiedlung in ihrer Entwickelung zum niederschlesischen Industrieorte, Weißstein, 1926, abrufbar auf Niederschlesischen Digitalen Bibliothek: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=15253, Zugang 17.01.2025.
[21] Riemann, W., Geschichte und Sagen der Burgen und Städte im Kreise, Breslau 1925, abrufbar auf Niederschlesischen Digitalen Bibliothek: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/12559/edition/11555?language=pl, Zugang 17.01.2025.
[22] Skowroński, Janusz, Pomnik Gerharta Hauptmanna ponownie stanął w Szczawnie-Zdroju, in: Przegląd Lubański, 26.09.2016, http://www.lubanski.eu/pomnik-gerharta-hauptmanna-ponownie-stanal-w-szczawnie-zdroju/#:~:text=W%20pi%C4%85tek%2023.09.,(1858)%2C%20tak%C5%BCe%20literat, Zugang 20.01.2025.
[23] Lempert Manfred, Zeitzeugeninterview, 04.01.2025, Rheine, 00:02:22, Familienarchiv Familie Palica.
[24] Lempert Manfred, Zeitzeugeninterview, 04.01.2025, Rheine, 00:01:48, Familienarchiv Familie Palica.
[25] Lempert Manfred, Zeitzeugeninterview, 04.01.2025, Rheine, 00:06:03, Familienarchiv Familie Palica.
[26] Waldenburg/Wałbrzych, Abschnitt „Zeitgeschichte“, https://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/orte/waldenburg-walbrzych#:~:text=Im%20Zweiten%20Weltkrieg%20unzerst%C3%B6rt%2C%20wurde,zwischen%201945%20und%201947%20vertrieben, Zugang 23.01.2025.
[27] Lempert Manfred, Zeitzeugeninterview, 04.01.2025, Rheine, 00:13:44, Familienarchiv Familie Palica.
[28] Lempert Manfred, Zeitzeugeninterview, 04.01.2025, Rheine, 00:16:53, Familienarchiv Familie Palica.
[29] Lempert Manfred, Zeitzeugeninterview, 04.01.2025, Rheine, 00:20:46, Familienarchiv Familie Palica.
[30] Sienkiewicz, Witold; Hryciuk, Grzegorz (hg.), Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939-1959. Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas, Bonn, 2010, S. 191.
[31] Es handelt sich höchstwahrscheinlich um Dichlordiphenyltrichlorethan, abgekürzt DDT, ein Mittel in Kriegszeit zur Läusebekämpfung benutzt.
[32] Flüchtlings-Meldeschein Nr. 134895, Manfred Lempert, Mariental, 17.05.1946, Familienarchiv Familie Lempert.
[33] Ein Beitrag von Jürgen Diehl, Niedersächsisches Landesarchiv – Abteilung Wolfenbüttel – https://histbrun.hypotheses.org/3811, Zugang 17.01.2025.
[34] Die Akten die Durchgangslager Mariental und Alversdorf betreffend befinden sich im Landesarchiv Wolfenbüttel. Der Bericht stammt von Johanne Flegel, die mit Flüchtlingszug Nr. 509 aus Breslau am 17.11.1946 nach Immendorf kam und wurde der Akte NLA WO 8 D Nds Nr. 86 entnommen, wir zitieren nach https://histbrun.hypotheses.org/3811, Zugang 17.01.2025.
[35] Bis zum August 1941 wurden in Deutschland über 70.000 psychisch Kranke und Behinderte im Rahmen der Aktion T4 ermordet. Herbert, Ulrich, Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, München, 2014, S. 415 u. f.
[36] Siehe: 150 Jahre LWL-Klinik Lengerich - Rezension, https://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft86/52-58_rezensionen.pdf, Zugang 23.01.2025.
[37] Lempert Manfred, Zeitzeugeninterview, 04.01.2025, Rheine, 00:32:03, Familienarchiv Familie Palica.
[38] Postkarte aus russischer Kriegsgefangenschaft, Alfred Lempert, wahrscheinlich 1944, Familienarchiv Familie Lempert.
[39] Lempert Manfred, Zeitzeugeninterview, 04.01.2025, Rheine, 00:52:18, Familienarchiv Familie Palica.
[40] Jähner, Harald, Wolfszeit: Deutschland und die Deutschen 1945 - 1955, Bonn, 2020, S. 95–97.
[41] Litten, Margot, Ablehnung und Verachtung für Landsleute aus dem Osten, 24.08.2016, https://www.deutschlandfunkkultur.de/vertriebene-ablehnung-und-verachtung-fuer-landsleute-aus-100.html, Zugang 19.01.2025.
[42] Jähner, Harald, Wolfszeit: Deutschland und die Deutschen 1945 - 1955 , Bonn, 2020, S. 93–94.
[43] Plato, Alexander von; Leh, Almut, Ein unglaublicher Frühling. Erfahrene Geschichte im Nachkriegsdeutschland 1945-1949, Bonn, 2011, S. 28.
[44] Plato, Alexander von; Leh, Almut, Ein unglaublicher Frühling. Erfahrene Geschichte im Nachkriegsdeutschland 1945-1949, Bonn, 2011, S. 28–29.
[45] Gesetz über die weitere Verbesserung der Lage der ehemaligen Umsiedler in der Deutschen Demokratischen Republik vom 08.09.1950, https://www.reichsgesetzblatt.de/D/GBl-DDR/1950/104-haupt.htm, Zugang 22.01.2025.
[46] Ther, Philipp, Vertriebenenpolitik in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR 1945 bis 1953, https://library.fes.de/library/netzquelle/zwangsmigration/45ddr.html, Zugang 19.01.2025.